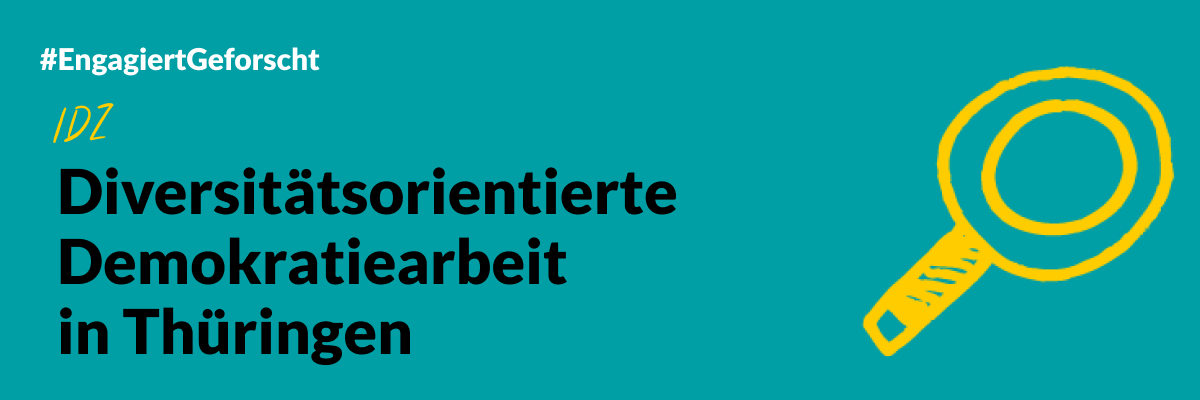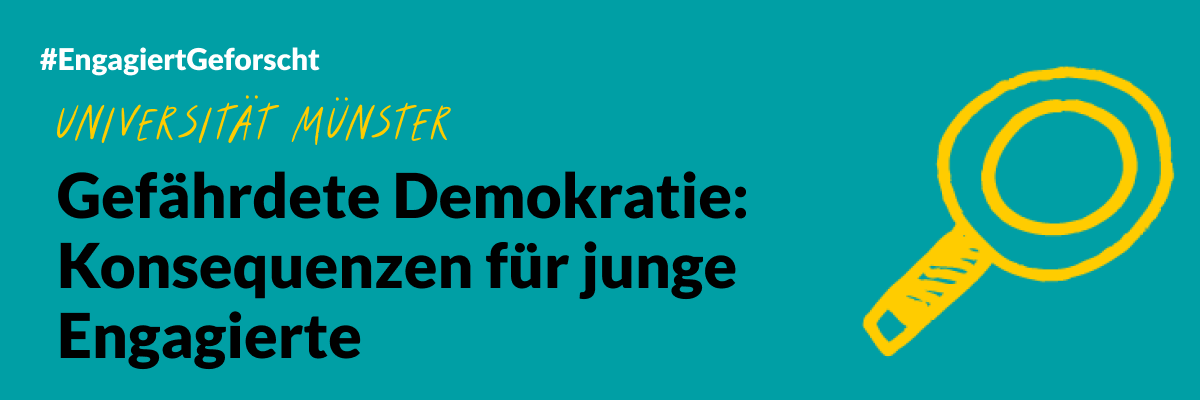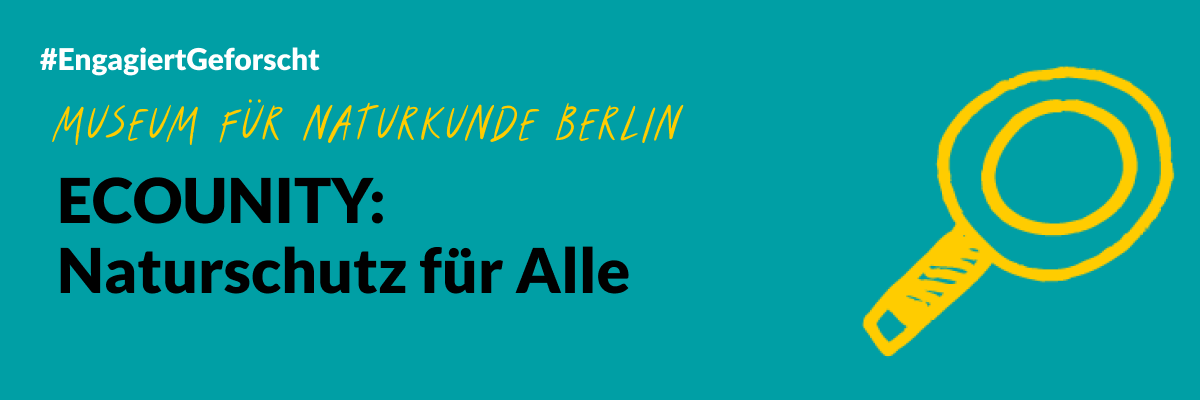Das Projekt fokussiert Engagementstrukturen der Demokratiearbeit im ländlichen Raum Thüringens. Mithilfe eines partizipativen Forschungsansatzes, welcher Selbstorganisationen
marginalisierter Communities sowie weitere Akteur:innen der Demokratiearbeit einbezieht,
wird untersucht,
a) wie sich Engagementstrukturen mit gesellschaftlicher Diversität
auseinandersetzen,
b) welche diskriminierenden Strukturen im Engagement vorliegen und wie
diese abgebaut werden können sowie
c) welche Auswirkungen politische Veränderungen auf
das Engagement in der ländlichen Demokratiearbeit haben.